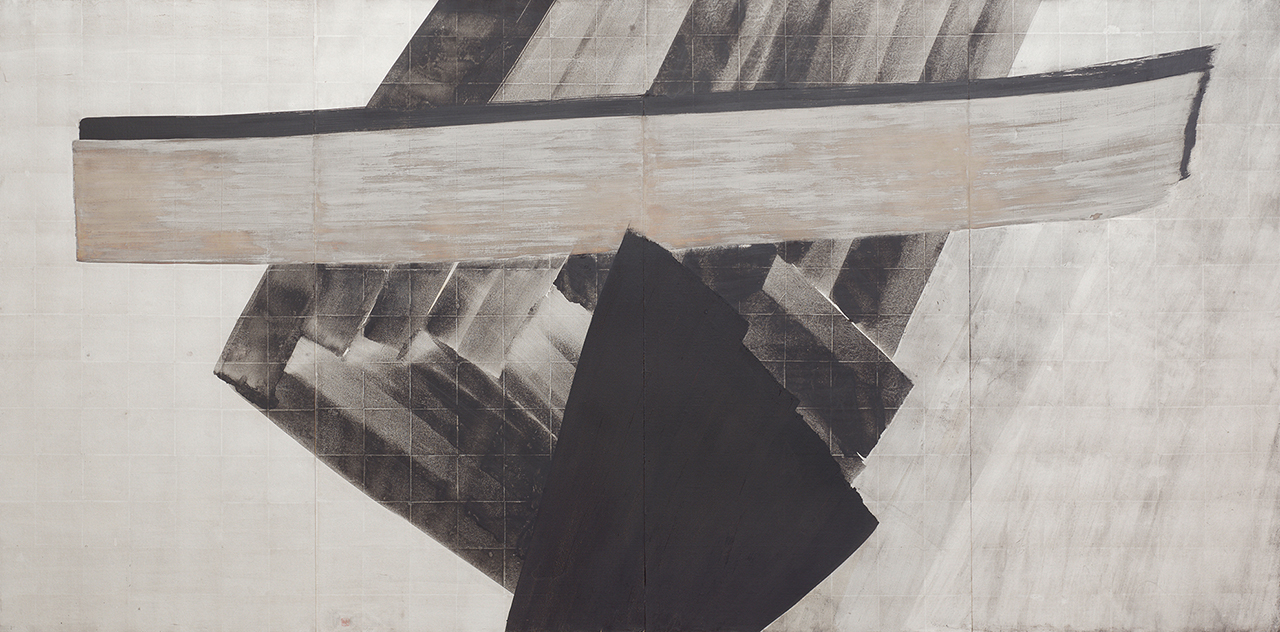Recap von dem „Hands on“-Areal im Forum DGIM FUTUR während des Kongresses
Hier wurde die digitale Zukunft der Inneren Medizin erlebbar. 20 Team-Mitglieder von Prof. Ivica Grgic, MD, PhD (Nephrologie & KI in der Medizin) und Prof. Dr. Martin Christian HIRSCH (Institut für KI in der Medizin) von dem Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) haben anhand von Prototypen aus der Forschung digitale Innovationen der Künstlichen Intelligenz (KI) […]